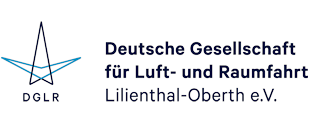„Die Satellitenmission GRACE-C ist ein Schlüsselprojekt“
Deutsch-amerikanischer Raumfahrtdialog unterstreicht die Wichtigkeit der „Wasserwaage im All“. Die dritte Generation des Satelliten-Duos wird derzeit geplant.
Beim ersten deutsch-amerikanischen Raumfahrtdialog in Berlin haben die GRACE-Satellitenmissionen eine zentrale Rolle gespielt. Das Kürzel GRACE steht für Gravity and Climate Recovery Experiment, eine zunächst experimentelle Weltraum-Mission, die aus Messungen der Schwerkraft wichtige Klimainformationen gewinnen sollte. Mittlerweile planen die US-Weltraumbehörde NASA, die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), und das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ die dritte Generation, weil die Messungen völlig neue Einblicke in das System Erde und vor allem in den globalen Wasserkreislauf ermöglicht haben.
Hochrangige Delegation aus den USA besucht Deutschland
Auf Einladung der Koordinatorin der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Dr. Anna Christmann, war eine hochrangige US-Delegation anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA (5.-9. Juni) ins Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nach Berlin gekommen. Der geschäftsführende Sekretär des Nationalen Weltraumrates der USA, Chirag Parikh, führte die Delegation an. In einem eigenen Panel stellten Forschende des Jet Propulsion Laboratory der NASA und des GFZ den Teilnehmenden des Raumfahrtdialogs das Messprinzip und die wissenschaftlichen Erfolge der Missionen GRACE (2002 bis 2017) und GRACE Follow-On (seit 2018 im All) vor. GRACE-C soll voraussichtlich 2028 starten, das C steht für Continuity.
Wie Wassermassen vom Weltall aus gemessen werden
GRACE misst Massenveränderungen auf und in der Erde, indem es deren Effekt auf ein Satelliten-Duo aufzeichnet, das mit 220 Kilometer Abstand (das entspricht in etwa der Entfernung von Berlin und Jena) hintereinander unseren Planeten in rund 500 Kilometer Höhe umkreist. Wird ein Satellit schneller, weil er als erstes auf ein massereiches Objekt zufliegt, vergrößert sich der Abstand um Bruchteile einer Haaresbreite. Mittels Mikrowellen und seit GRACE Follow-On auch per Laser-Interferometrie können diese Abstandsänderungen gemessen werden. Hinzu kommen GPS-Empfänger an Bord sowie Beschleunigungsmesser, um einerseits die Position der Satelliten zu bestimmen und andererseits Bremseffekte zu erkennen, die etwa durch Reibung an atmosphärischen Teilchen entstehen.
Aus all diesen Daten errechnen die Forschenden monatliche Karten der globalen Änderungen der Erdanziehungskraft und der dazugehörigen Massenveränderungen. Diese beinhalten Variationen im Grundwasser, der Bodenfeuchte, von Oberflächengewässern oder Schnee- und Eisbedeckung. Mit Hilfe von komplementären Beobachtungen oder Modelldaten lassen sich so aus GRACE-Daten einzigartig beispielsweise Grundwasserveränderungen global und auf monatlicher Basis ableiten.
Lange Zeitreihen sind essenziell
Die Messungen seit mehr als 22 Jahren zeigen zum Beispiel für Grönland einen dramatischen Verlust an Eismasse: mehr als 250 Milliarden Tonnen jedes Jahr. Aber auch Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten Wassermasse verloren. Trotz des nassen Jahres 2023 fehlen nach den schweren Dürrejahren seit 2018 immer noch rund 10 Milliarden Tonnen im Gesamtwasserspeicher.
Für die Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung ist GRACE-C „ein Schlüsselprojekt“. Anna Christmann sagte: „Wir brauchen Langzeitstudien, um das Klima zu verstehen. Die Datensammlung zum globalen Wasserhaushalt der Erde, die durch die GRACE-Satelliten seit über 20 Jahren erzeugt wird, ist daher von enormer Bedeutung. GRACE-C ist deshalb auch ein wichtiges Schlüsselprojekt der neuen Raumfahrtstrategie der Bundesregierung, da es in den Handlungsfeldern Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit große Beiträge zur Umsetzung der Ziele leistet. Die Mission ist ein absolutes Leuchtturmprojekt.“
Auch Susanne Buiter, wissenschaftliche Vorständin des GFZ, betonte die Bedeutung der langen Zeitreihen: Ziel sei es, mit dem Start von GRACE-C voraussichtlich im Jahr 2028 dann eine Klimaperiode von insgesamt 30 Jahren erfassen zu können. Sie lenkte den Blick noch einmal auf das revolutionäre Messprinzip und dessen Geschichte, die auch mit dem ersten Satelliten des GFZ verbunden sei. GFZ-1 war 1995 von der russischen Raumstation „Mir“ aus ins All gebracht worden und kreiste fünf Jahre lang so tief um die Erde, dass die Auswirkungen des Schwerefelds deutlich messbar seine Bahn beeinflussten. „Dass wir aus Schwerefelddaten einmal die Folgen der Erderwärmung und insbesondere Veränderungen im globalen Wasserkreislauf wie Dürren, Grundwasservariationen oder Eismassenverluste so genau würden bestimmen können, war damals kaum zu glauben. Und heute blicken wir auf mehr als zwei Jahrzehnte mit monatlichen Schwerefeldkarten zurück“, sagte Susanne Buiter.
Dr. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, hob bei der gemeinsamen Pressekonferenz hervor, dass die Forschung weltweit von den gewonnenen Daten profitiere: „GRACE und GRACE-FO gehören zu den am häufigsten zitierten Missionen in den Berichten des Weltklimarates IPCC. Tausende von wissenschaftlichen Publikationen basieren auf den Daten der beiden Satelliten-Duos. Dies unterstreicht die herausragende internationale Vernetzung der deutschen Erdsystemforschung und die hohe Bedeutung der GRACE-Missionen. So können durch den Klimawandel bedingte Veränderungen dokumentiert und mit mehrjährigem Vorlauf Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung geplant werden.“
Dr. Walther Pelzer, Vorstand der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, lenkte den Blick auf die deutsch-amerikanische Kooperation. Die Partnerschaft zwischen dem Jet Propulsion Laboratory der NASA und den deutschen Partnern „ist ein Zeichen für die Qualität der Raumfahrtindustrie und -wissenschaft in Deutschland“, so Pelzer.
Hintergrund zu GRACE-C
Der deutsche Beitrag wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter Beteiligung des Deutschen GeoForschungsZentrums (GFZ) in Potsdam und des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Hannover umgesetzt. Gebaut werden die beiden Satelliten im Auftrag des NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) bei Airbus in Friedrichshafen.
Herzstück der GRACE-C-Mission ist dabei die präzise Messung von winzigen Abstandsabweichungen zwischen den beiden Satelliten auf ihrem Weg um unsere Erde. Bei GRACE-C wird diese Entfernung mittels Laser-Interferometrie bestimmt. Wichtige Teile des Instruments kommen dabei von der SpaceTech GmbH in Immenstaad (STI), unterstützt vom Albert-Einstein-Institut in Hannover im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR.
Das GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam wird für den Aufbau und die Durchführung der wissenschaftlichen Auswertungen im sogenannten Science Data System (SDS) auf deutscher Seite zuständig sein. In der Betriebsphase nach dem Start der beiden Satelliten wird das GFZ für den operationellen Betrieb, also die permanente Überwachung und Steuerung der Instrumente und der Satelliten von GRACE-C, verantwortlich sein. Wie bereits bei GRACE und GRACE-FO werden auch die beiden GRACE-C Satelliten, im Auftrag des GFZ, nach dem Start durch das Deutsche Raumfahrtkontrollzentrum im DLR (GSOC) in Oberpfaffenhofen gesteuert.
Quelle: https://idw-online.de/de/news835265