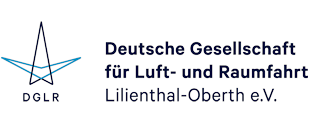Internationale Weltraumwetterforschung zum Schutz irdischer Infrastrukturen
Das Weltraumwetter hat erheblichen Einfluss auf die Leistung und Zuverlässigkeit von technologischen Systemen. In 2025 erreicht die Sonne wieder einen Höhepunkt ihrer Aktivität, wie das vermehrte Erscheinen von Polarlichtern aktuell in Deutschland zeigt. Die Forschung des Instituts für Solar-Terrestrische Physik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zielt darauf, technologische Infrastrukturen im All und auf der Erde vor Schäden durch das Weltraumwetter zu schützen. Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt treffen sich vom 10. bis 14. Juni 2024 in Neustrelitz zu einem Workshop der Internationalen Initiative für Weltraumwetter (ISWI) des Ausschusses der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums, um sich über aktuelle Forschungsprojekte und zukünftige Zusammenarbeit auszutauschen.
Das Weltraumwetter ist nicht nur auf den Weltraum beschränkt, sondern hat enorme Auswirkungen auf die irdische Infrastruktur. Strahlungs- und Plasma-Ausbrüche der Sonne können unterschiedlich intensiv sein. Normalerweise schützt uns das Erdmagnetfeld davor. Allerdings können bestimmte Sonnenaktivitäten wie solare Flares oder koronale Massenauswürfe elektromagnetische Strahlungen und riesige Mengen an ionisierten Teilchen in den Orbit schleudern und das Schutzschild der Erde durchdringen. Dies kann zu Satellitenausfällen sowie zu Störungen der Stromversorgung führen. Auch die Bordelektronik von Schiffen, Flugzeugen und Autos sind gefährdet. Um auf solche Ereignisse vorbereitet zu sein und präzise Vorhersagen darüber treffen zu können, arbeiten Forschende weltweit in gemeinsamen Projekten.
Freizugängliche Weltraumwetterdaten
ISWI ist ein Programm, das die internationale Zusammenarbeit im Bereich Weltraumwetterforschung fördert sowie eine internationale Struktur für freizugängliche Weltraumwetterdaten für Forschung, Lehre und Services aufbaut. Ein besonderer Schwerpunkt des Programms liegt auf dem Einsatz von Instrumenten und der Unterstützung der Forschung in Entwicklungsländern.
„Das Netzwerk des ISWI besteht momentan aus mehr als 1.000 Messinstrumenten weltweit in über 100 Ländern“, sagt Daniela Banyś, Wissenschaftlerin am DLR-Institut für Solar-Terrestrische Physik und nationale und europäische Koordinatorin des ISWI. Das Institut stellt dem ISWI aktuell Daten der Netzwerke SOFIE (SOlar Flares detected by Ionospheric Effects), GIFDS (Global Ionospheric Flare Detection System) sowie CALLISTO (Compound Astronomical Low frequency Low cost Instrument for Spectroscopy and Transportable Observatory) zur Verfügung. „Diese bestehenden Messnetze sollen künftig erweitert, aber auch neue Messnetze aufgebaut werden“, erklärt Banyś.
Diese Daten nutzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die physikalische Modellierung des Sonne-Erde-Systems, um ein besseres Verständnis über die Prozesse zu bekommen und präzisere und schnellere Vorhersagen treffen zu können.
Forschende erarbeiten Empfehlungen
Die Forschenden des ISWI erarbeiten Empfehlungen für die Durchführung von weltraumwetterbezogenen Messungen und den Datenaustausch. Dabei orientieren sie sich an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den darin festgelegten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG). Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Anschluss dem Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums (COPUOS) bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt.